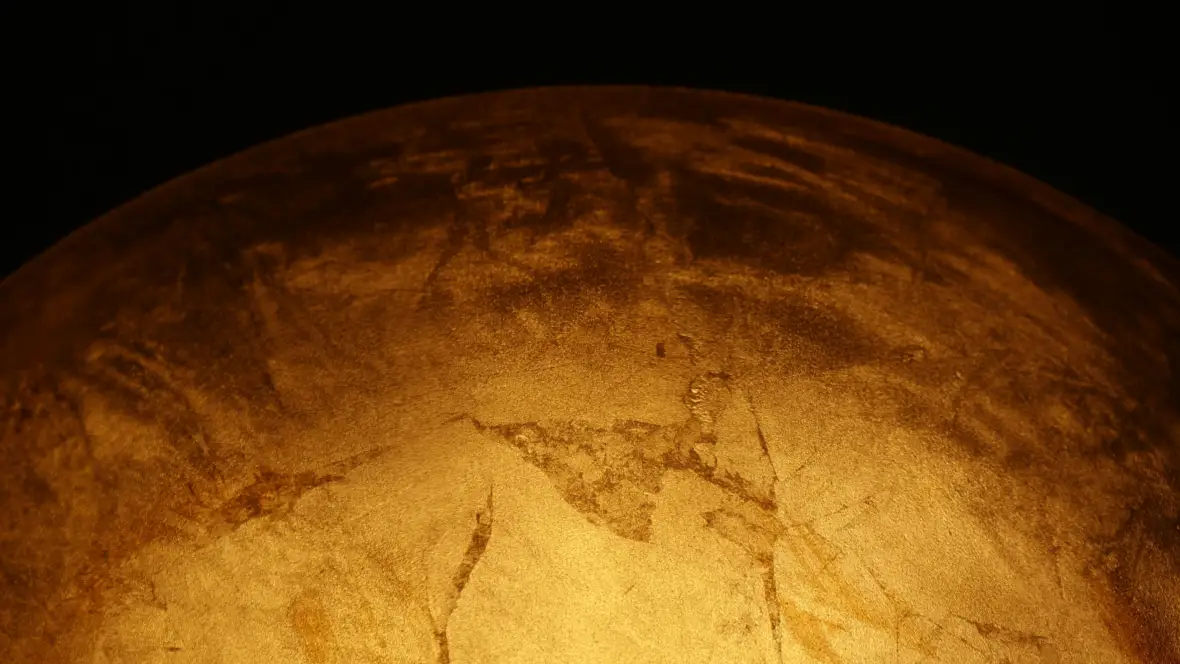
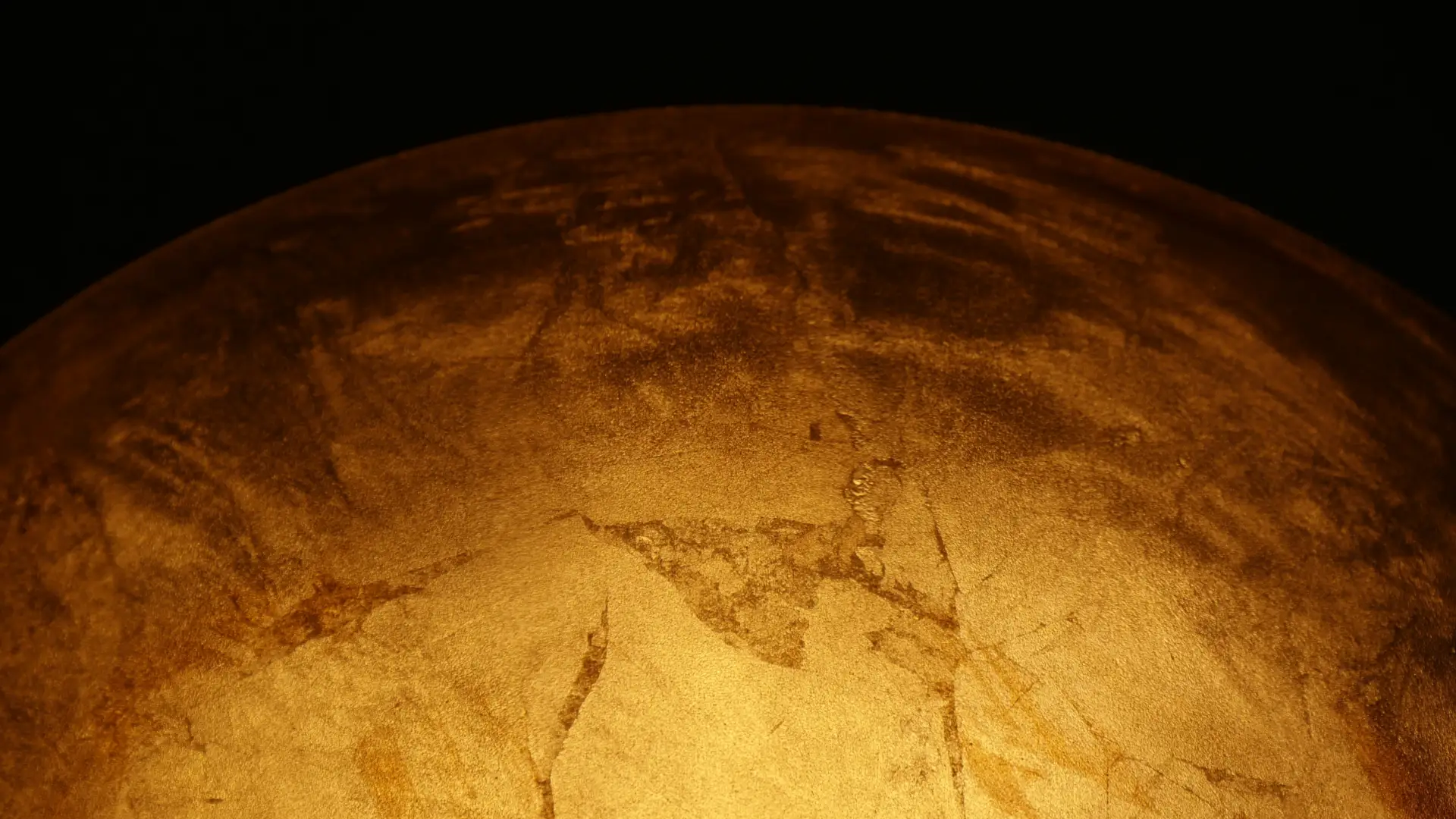

Warum Ethik überall wichtig ist
Die Gesellschaft ist im Wandel. Das Herrschafts-Denken, das im Mittelalter noch sehr präsent ist, löst sich auf. Gleichberechtigung aller Menschen ist ein grosses Anliegen in unserem Zeitgeist. Und selbst WenigverdienerInnen leben heute so annehmlich wie frühere Königinnen und Könige. Wir müssen nicht frieren, haben einfachen Zugang zu einer Vielzahl von regionalen und exotischen Früchten und Lebensmitteln - und können unsere Interessen und Fähigkeiten unabhängig von unserem persönlichen oder kulturellen Hintergrund in viele Richtungen frei entwickeln.
Das schreibe ich aus der Perspektive eines Berners und Schweizers, ein Land mit grossen Privilegien. Auf vielen Orten der Welt ist Hunger, Kampf um ein sicheres Zuhause weiterhin ein grosses Thema. Die Ungleichheit ist im globalen Kontext weiterhin sehr präsent. Und mitunter auch stark durch unseren Einfluss geprägt. Unser Marktsystem drückt auf niedrige Import-Preise und bedingt so die mitunter unwürdigen Arbeits- und Lebens-Bedingungen in anderen Ländern. Und das Marktsystem formen wir alle. Wir leben im Konsumzeitalter und haben dabei hohe Ansprüche.
Unser starker Konsum treibt nicht nur die soziale globale Ungleichheit an, sondern auch die Zerstörung von Lebensräumen, die Dezimierung und Ausrottung von Tierarten. Der Mensch ist im Begriff die sich über Jahrmillionen entfaltende Evolution zurück an den Anfang zu setzen und erzeugt dabei viel Leid.
All diese Themen sind die letzten Jahre stark präsent in Gesprächen, Nachrichten, Büchern, Filmen und anderen Berichten. Gleichzeitig werden die digitalen Plattformen in immer mehr Lebensbereichen wichtig für uns. Die meisten von uns sind täglich im Internet unterwegs und benutzen regelmässig Apps, Programme und Software. Mein Eindruck ist, dass es trotz der Wichtigkeit von Technik und Internet in diesem Kontext wenig Reflexionen und Bewusstheit gibt, was Sachen Nachhaltigkeit und Ethik betrifft. Das Internet wird zu einer Parallelwelt in der die uns üblichen Gesetze und moralischen Vorstellungen nicht oder nur bedingt gelten. Mit diesem Bericht trage ich einige Punkte zusammen, um dazu zu inspirieren die digitale Ethik gesellschaftlich zu debattieren und bei wichtigen Entscheidungen präsent zu haben. Wir sind Gestalter dieser Welt. Was wollen wir wirklich?
Natur und soziale Solidarität
Wertschöpfung: Hardware ohne Hintergedanken
Die ganze digitale Welt, im beruflichen Bereich für die Rechenzentren, die Büroausstattung, Computer, Verkabelungen, sowie im alltäglichen Einsatz zuhause, mit Laptops, Smartphones, Fernsehgeräten, Lautsprechern etc. In unserem Leben sind bei fast allen von uns technische Geräte wichtiger Bestandteil unserer Beschäftigungen und Aufgaben.
Dabei wird in der Industrie-Kette zur Herstellung der elektronischen Geräte wenig bis kein Wert auf nachhaltige Wertschöpfung gelegt. Plastiksynthesen und seltene Metalle werden unter fragwürdigen Bedingungen aus der Erde geholt und verpresst und in Automation und Fliessbandarbeit zu Massen produziert. Wenn man einen Tisch im Wohnzimmer aufstellen möchte, kann man entscheiden ob man selber eine Platte mit Beinen zusammenschraubt, ob man zu einem Schreiner in der Gegend geht oder zu dem Möbelhaus des Vertrauens. Man kann sich entscheiden zwischen Buchenholz und Ahorn, und mit Labeln kann man sich im Handel Transparenz verschaffen, ob das Holz aus nachhaltigem Anbau kommt oder aus, bis an Extreme gepushten, Holzzucht-Wäldern. Im Landbau können wir transparent zwischen verschiedenen konventionellen und biologischen Labeln unterscheiden, die uns Klarheit geben, wie der Boden und die darauf wachsenden Früchte & Lebensmittel gepflegt, genährt und geerntet werden. Es wird ausserdem klar deklariert, wenn exotische Produkte fair gehandelt wurden, was leider keine Selbstverständlichkeit ist.
In der Technik-Industrie ist es anders. Elektronik ist kein Jahrhundert altes Traditionshandwerk und es gibt keine schonenden Alternativen. Der Prozess ist von Anfang auf extreme Geschwindigkeit und billige Preise ausgelegt. Die meisten Elektronikgeräte haben zumindest in Anteilen die halbe Welt umreist. Die Zusammensetzung geschieht in Extremtempo zu teilweise unwürdigen Arbeitsbedingungen. Die ganze Elektronikindustrie kennt dabei weder Transparenz noch Label zur Klärung von Hintergründen bzgl. Nachhaltigkeit, Handel und Arbeitsbedingungen. Die einzige grössere Firma die eine kleine Bewegung in diese Richtung macht ist Fairphone, doch selbst diese Geräte sind von Umwelt-Reports als klar nicht nachhaltig deklariert. Anstatt die Forschung auf immer neue Geräte auszurichten, wäre es aller-höchste Zeit die bestehenden Prozesse zu reformieren und nachhaltige Wertschöpfungs-Wege zu finden und in der Wirtschaft zu etablieren.
Entwicklung: Regionalität vs. Outsourcing
Sind die Hardwaregeräte erst einmal beisammen, werden darauf Betriebssysteme und Anwendungen, Apps, Programme, Spiele und Webseiten entwickelt. Dieser Prozess ist nicht so intransparent wie die Hardware-Gewinnung, aber bleibt abstrakt. Wenn man als Anwender Klarheit haben möchte, wie genau die Software entwickelt wurde, kann man sich auf der Webseite des Produkts oder der jeweiligen Anwendung über die Firma informieren. Je nach Firma findet man mehr oder weniger Informationen zur Philosophie und zu den Werten der Organisation. Doch mit den EntwicklerInnen direkt in Kontakt zu kommen ist selten möglich. Applikationen sind oft für einen globalen Markt ausgerichtet und entsprechend sitzen die ProgrammiererInnen überall auf der Welt.
Ein Trend ist dabei das sogenannte Outsourcing. Grossfirmen haben ihren Hauptsitz in privilegierten Ländern und ziehen von dort die Fäden. Die eigentliche Coding-Arbeit wird dann von günstigen Fachkräften aus dem Ausland erledigt. Das führt einerseits zu einer Auflösung von sozialen Bindungen, denn die Koordination zwischen dem Hauptsitz und den Sitzen in anderen Ländern kann nur digital erfolgen. Man arbeitet mit Menschen zusammen, denen man vielleicht niemals im Leben persönlich begegnet. Zudem ist dieses Model ethisch fragwürdig. Und es entfernt den Anwender noch mehr von den Hintergründen der Software.
Zumindest ist es Anwendern oftmals möglich sich auf Webseiten mit etwas Geduld schlau zu machen, in welchen Standorten entwickelt wird. Hier zeigt sich aber gleich eine weitere Crux im Netz. Anwender sind überhaupt nicht auf solche Themen sensibilisiert. Software und Apps existieren einfach. Woher sie kommen oder was dahintersteckt ist kein Kriterium bei der Auswahl. Lediglich die Funktionalität wird überprüft. Ausnahmen kommen nur durch Skandale zu Stande. Wenn Riesenkonzerne wie Google mal wieder mit undurchsichtiger Privatssphäre in der Presse stehen, erfahren alternative Plattformen ein wenig Aufwind. Es gibt bei Anwendern eine gewisse Offenheit passiv Informationen zum Thema Ethik aufzunehmen. Aber aktiv erkundigt sich fast niemand vor dem Verwenden einer Software, was dahinter steht.
Dies ist unter anderem auch der hohen Abstraktions-Ebene der Informatik geschuldet. Hier ist die globale Zerstreuung ein Problem. Man kann nicht wie bei dem Holztisch zum Schreiner des Vertrauens gehen und nachfragen was dahintersteht. Oder wie in manchen Bauernbetrieben möglich einmal ein Wochenende auf dem Hof mithelfen oder Urlaub machen.
Zudem sind die technisch-basierten Informationen für Laien oft kryptisch und schwer verständlich. Der massgenaue, stilvolle Bau von einem Möbel ist eine Kunst, die viel Erfahrung bedarf. Aber doch kann man auch als Laie verstehen was eine Säge ist und wozu Nägel dienen. Um die technischen Grundlagen zu verstehen, die in der Informatik zu Grunde liegen, Bedarf es eine ausgiebige Schulung von abstrakten Zusammenhängen, die so anders sind als die intuitiven Vorgänge, die man beobachten und erleben kann, wenn man in Gesellschaft oder in der Natur ist.
Zum Wohle von Umwelt und sozial-vertretbaren Anwendungen braucht es entweder eine eine gesamt-gesellschaftliche Sensibilisierung und Schulung in den Grundlagen der Informatik oder vertrauenswürdige Gremien und Reglements, die ethische Lösungen deklarieren bzw. sogar dafür sorgen, dass klar unethische Lösungen auf dem Markt nicht zugelassen werden.
Betrieb: Ressourcenverbrauch
Wenn die Hardware in unseren Händen ist und die Software läuft - eigentlich beides ein Wunder, dass nur selten in der Tiefe wertgeschätzt wird - erwarten wir als Anwender permanente Funktionalität.
Im Internet ist dabei zu bedenken, dass eine Webseite nicht einfach da ist und irgendwo in der Cloud rumschwirrt. Alle Texte, Bilder und Dateien aus denen Webseiten aufgebaut sind, werden ganz physisch auf Festplatten gespeichert. Es laufen Server, es ist ein immenses globales Router-Netz aktiv, Leitungen werden verlegt etc. etc. etc. All das frisst immense Mengen an Strom. Deklariert das Pressemagazin _die Zeit_ ihre Printausgaben mit Papier aus nachhaltigem Ursprung, so findet man im Impressum der Webpage des Unternehmens keine Angabe, ob die Server mit ökologischem Strom betrieben werden. Hier braucht es in meinen Augen Bewusstheit und klare Deklarationen. Ggf. auch schon in Kooperation mit den Suchmaschinen. Eine einfach-denkbare Möglichkeit wäre es ein Zertifikat einzurichten. In den Suchmaschinen wird dann der Anwender mit einem Ampelsystem als Teil des Eintrages in der Suchergebniss-Liste über die ethische Integrität der Seite informiert. Die Stromquelle und der Stromverbrauch der Server kann dabei ein wesentliches Kriterium sein. Auch wie die Server programmiert sind ist massgeblich. Schnell entwickelte Lösungen sind dabei tendenziell ressourcen-intensiver, weil weniger auf die konkrete Anwendung zugeschnitten.
Weiterführende Gedanken dazu habe ich im Artikel zu nachhaltiger Webentwicklung beschrieben, in dem ich auch genauer unterscheide zwischen der Nachhaltigkeit von massgeschneiderten Weblösungen von Profis und den DIY-Websitebuildern mit denen auch Laien für ihr eigenes Projekt vergleichsweise einfach Webseiten gestalten können.
Eine Behauptung die oft kursiert ist die, dass die Digitalisierung in Betrieben per se nachhaltig ist, da sie die Prozesse weg vom Papier bringt, welches ja erst noch aus Bäumen gewonnen werden muss. Unter Berücksichtigung der fragwürdigen Hardware-Wertschöpfung und Entwicklung, sowie dem Strom den der Betrieb der gesamten Infrastruktur von Internet und Geräten benötigt, würde ich diese Behauptung in Zweifel ziehen bzw. relativieren. Eine Mind-Map im Team auf einem grosssen Blatt Papier zu erstellen ist vermutlich effizienter als der Aufbau für das Team mit Projektion via Beamer. Geschweige der Situation wenn der Bildschirm übertragen wird und sich einige Team-Mitglieder parallel in dem verwendeten Konferenztool einloggen und den ressourcenhungrigen Screencast auf eigenen Geräten empfangen. Das ist natürlich nicht nachhaltig. Es gibt aber mit Sicherheit auch Einsatzgebiete geben in denen die digitalen Prozesse ressourceneffizienter sind als die Verwendung von Papier. Wir brauchen eine allgemeine Bewusstheit die in unsere alltäglichen Entscheidungen einfliesst und von Fall zu Fall nachhaltige Lösungen findet.
Ich möchte auch dazu inspirieren im Internet mutig zu sein. Eine Idee in diese Richtung ist die Einführung von einer Nachtphase auf der eigenen Webseite. Wenn man eine regionale Webseite betreibt, kann man sie durchaus auch auf die entsprechende Zeitzone eintunen und die Server von 11 bis 06 Uhr weitestgehend abschalten und auf eine einfache Nachtruhe-Seite verweisen, die die Öffnungszeiten und ggf. wichtigsten Informationen bereitstellt. Das würde auch uns als Gesellschaft guttun. Dem Trend der ständigen Betriebssamkeit entgegenwirken und Quellen der Ruhe etablieren. Ganz ehrlich: Wer braucht schon um 03 Uhr morgens Zugriff aufs Online-Banking?
Ein sicheres und glückliches Leben
Gesellschaft
Ein grosses Thema ist der Einfluss von der Technik auf unsere Gesellschaft. Hier gibt es viele ethische Themen, die bereits vergleichsweise viel diskutiert werden und uns geläufig sind aus philosophisch-gesellschafatlichen Gesprächen und Prognosen, und sogar aus einigen Science Fiction Novellen und Filmen. In Kürze:
Mit steigender Abhängigkeit zur Technik, mit dem unreflektierten Anvertrauen all unserer persönlichen Daten an ominöse Riesenkonzerne, mit der Auflösung von echter sozialer Kontakte hin zu oberflächlicher und einseitiger Sinnesflut, mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz... Mit all dem sind wir im Begriff von einem radikalem Wandel unserer Form der Existenz. Der bekannte Historiker Yuvel Noah Harrari prognostiziert in seinen Büchern das mögliche Ende von homo sapiens in sehr naher Zukunft. Und ist damit nicht der einzige Vertreter der eine Welt im Scheitern zu beobachten meint.
Es kommt, was kommen soll, und vielleicht sind die dunklen Visionen nichts als Dystopien. Dennoch ist es sicherlich weise wo immer wir können langsam und bewusst an die Veränderungen heranzugehen. Und gründlich zu erwägen, ob die Erforschung neuer Technik wirklich notwendig ist. Ob eine neue Technik wirklich eingesetzt werden muss. Oder ob es nicht sinnvoller wäre grössere Schritte über einige Jahrzente oder sogar Jahrhunderte ganz bewusst vorzubereiten. Unterdessen haben wir ja genug globale Herausforderungen zu lösen. Ein paar wenige Eckpunkte davon, notiere ich in diesem Bericht. Und um die extremste Ausprägung unserer gesellschaftlichen Baustellen zu nennen: Wir leben im 21. Jahrhundert und führen immer noch Kriege. Keine Technik der Welt kann an tief-liegenden Phänomenen wie kollektiven Wutausbrüchen, bishin zu Krieg etwas ändern. Es braucht einen grundsätzlichen Bewusstseinswandel und der beginnt bei uns selbst und kann uns von keiner Software abgenommen werden.
Gestaltung der digitalen Welt
Auch vergleichsweise oberflächlich reflektiert erlebe ich den Geschmack und die Atmosphäre der Welt die wir mehr und mehr manifestieren. Das Internet soll einfach irgendwie laufen und wir wollen irgendwie an die Informationen kommen die wir brauchen. Wo ist unsere Kreativität geblieben? Sollten nicht eher Soziologen und Künstler die Architektur des Web bestimmen anstatt Forscher, Techniker und Wirtschaftsleute? Klar Forscher und Techniker sind essentiell und braucht es für die Entwicklung und Umsetzung von Visionen im Web. Und Wirtschaftsleute können die Visionen zu einem realistischen Rahmen formen. Aber insbesondere Wirtschaftler an den Schalthebel der Technologie zu setzen, halte ich für sinnesfremd. Worum geht es hier? Blinden Wachstum?
Dass blinder Wachstum nicht unbedingt produktiv ist sondern teilweise eher ungesunde Auswüchse annimmt, zeigt sich in meinen Augen zum Beispiel an der Werbungs-Schwemme im Web. Wer seine Informationen noch ganz klassisch aus Büchern bezieht, zahlt seinen direkten Preis an die PublikatorInnen und AutorInnen. Im Web muss alles gratis sein. Immer frei zugänglich. Doch was ist der Preis von dieser open-door policy? Informationen verlieren ihren Wert und werden als selbstverständlich betrachtet. Der Schlupfwinkel um die gute Arbeit die hinter Informationsbeschaffung steckt zu entlöhnen, ist es Einnahmen durch Werbung zu generieren. Und so wird Information noch weiter "verschmuddelt", denn jedes Wissenspartikel kann nur noch in Verknüpfung mit zufällig generierten Konsumangeboten aka. Werbung eingesehen werden. Keine gute Suggestion für unsere Neuronen und unsere unterbewusste Konditionierung, die wiederum unsere Gewohnheiten prägt. Und nicht selten ist dabei die Werbung sensationsgeladen um möglichst aufzufallen. Das ist nicht förderlich für wissensklare Individuen. Kein guter Schachzug weder für die Wirtschaft noch für das persönliche Glück in der Gesellschaft.
Wir reflektieren nicht. Wir verwenden die kursierenden Geräte einfach. Doch haben wir die Kompetenz sie zu bedienen? Niemand gibt seinem Kind eine Säge in die Hand ohne ihm zu erklären wie man sie hält und bedient. Geschweige-denn wenn die Säge elektrisch betrieben ist und das Rotorblatt in einer derart hohen Drehzahl schwingt, dass ein feines Surren in der Luft erklingt. Doch die Technik ist anders als eine Säge. Sie kam aus dem Nichts zu uns und wurde in wenigen Jahrzehnten wichtiger Teil vieler unserer Abläufe. Da waren keine Eltern die den GrundsteinlegerInnen des Internets erklärt haben, wie es zu bedienen ist. Und auch neue Generationen haben keine Einführung bekommen. Wenn man Glück hat wird einem ordentlich erklärt wie man Excel bedient. Aber wirklich einen bewussten Zugang zu der Technik zu haben, das zeigt uns niemand.
Jetzt ist es Zeit aufzuräumen. Und das Werkzeug zu einem solchen zu machen. Das wir verwenden können, aber auch wieder ablegen. Es ist wichtig Kompetenz zu entwickeln und geordnete Verhältnisse zu schaffen. Wozu verwende ich Smartphone und Computer? Was tue ich nur, weil die Software diesen Weg durch die vorhandenen Möglichkeiten so einkerbt? Und was will ich eigentlich, wenn ich die Geräte abschalte und einfach für mich meine Absicht kläre? Gibt es vielleicht andere Wege, die meinen eigentlichen Zielen näher kommen? Was speichere ich in Geräten? Wer hat ausser mir auch noch Zugriff darauf? Was ist meine Absicht? Führen meine Schritte zum gewünschten Ziel? Ganz normale Fragen für einen Schreiner. Bevor er das Holz zersägt weiss er haargenau für was er das Brett zuschneidet. Doch im Internet ist Bewusstheit um die eigene Absicht, so mein Eindruck, eher die Ausnahme. Das was passiert, passiert einfach. Es kommt über uns. Wie Schlafwandler klicken und träumen wir uns durch die digitale Landschaft, ohne Ziel und nicht selten ohne Gewissen, ja sogar ohne Wissen um Gewissen. So selbstverständlich ist für uns die Haltung. "Macht ja nichts. Ist ja nur im Interrnet". Naja.
Auch die physischen Umstände in denen wir Geräte bedienen sind zu hinterfragen. Wie kann es sein, dass obwohl immer mehr Arbeitsstellen ins Digitale wandern, sich niemand stark macht für Programmierung an der frischen Luft? Gerade im Sommer, ist das mit einfachen äusseren Vorkehrungen (insbesonders Sonnnenschutz) kein Problem. Es ist hinlänglich erforscht, dass eine natürliche Umgebung Körper und Geist mehr als gut tun. Auf unserer Agenda steht es trotzdem nicht. Stattdessen planen und buchen wir lieber Ferien in der Sonne.
Doch es gibt in diesem Bereich auch Bewusstheit. Arbeit im Sitzen ist üblich, aber auch Stehpulte sind im Trend. Vielleicht etabliert sich auch eines Tages eine Arbeitsfläche mit von Sonnenkraft betriebenen Laufteppichen unter unseren Füssen, die auf einer sommerlichen Denkwiese ausliegen, gerade hinter der Terrasse der regional-saisonal-biologisch kochenden Kantine auf der Südseite des lichtdurchfluteten Büro-Gebäudes. Wir alle haben Momo gelesen, oder? Wann genau haben sich die grauen Männer in unsere Gehirnzellen eingeschlichen? Wann haben wir aufgehört zu träumen?
Ich bin studierter Informatiker, aber im Studium wurden all diese Themen nicht besprochen. Das hier ist kein wissenschaftliches Dokument, sondern ein persönlicher Zusammentrag von Informationen. Hast Du ergänzende Gedanken, Inspirationen, Quellen und Studien, die weiter in genannte Themen führen? Kennst Du Netzwerke und Bewegungen, die sich bereits um solche Fragestellungen kümmern? Willst Du mich auf eine nicht bis in die Tiefe fertig-reflektierte oder sogar mutmasslich fehlerhafte Aussage aufmerksam machen? Ich freue mich sehr von Dir zu lesen!

